Sachverständigenfortbildung 2024 - Bericht
Fortbildung für Sachverständige nach § 18 BBodSchG am 7. Februar 2024
Die GAB veranstaltete gemeinsam mit der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS), in Kooperation mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) sowie dem Ingenieurtechnischen Verband für Altlastenmanagement und Flächenrecycling e. V. (ITVA), Regionalgruppe Bayern, auch in diesem Jahr eine Fortbildung für Sachverständige nach § 18 BBodSchG. Das Seminar fand erstmals als hybride Veranstaltung statt und war mit rund 190 Teilnehmenden (rund 80 in Präsenz und rund 110 Online) sehr gut besucht.
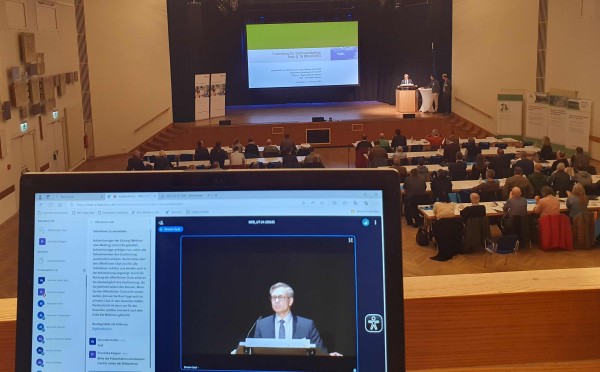
Dr. Andreas Hofmann, Bild der BVS, Frau Hutter
Zu Beginn der Veranstaltung begrüßten Herr Dr. Andreas Hofmann, Geschäftsführer der GAB, Herr Tim Asam, Vertreter der ITVA Regionalgruppe Bayern und Herr Matthias Heinzel, Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) die Teilnehmenden.
Im ersten Themenblock Aktuelles und Neuerungen berichtete Herr Matthias Heinzel über aktuelle Themen am LfU. Zunächst gab Herr Heinzel bekannt, dass er als Nachfolger von Dr. Gernot Huber (in Ruhestand) im August 2023 die Leitung des Referats 96 übernommen habe und Herr Dr. Martin Biersack sein Stellvertreter sei. Er informierte, dass nun alle LfU-Merkblätter bis auf 3.8/2 „Vergabe“ aktualisiert und 2023 veröffentlicht wurden. Bei Merkblatt 3.8/7 Historische Erkundung wies Herr Heinzel auf die neuen, erweiterten Möglichkeiten der Beschaffung von Karten (u. a. Rahmenvereinbarung zwischen KVB und StMFH; open-Data Freigabe; BayernAtlasplus) und von Luftbildern (Luftbild-Recherchestation der LDBV mit ca. 1,4 Mio. historischen Luftbildern ab 1941) hin. Zum Thema PFAS berichtete er, dass die jährliche Bestandsaufnahme Ende 2023 (136 PFAS-Fälle) abgeschlossen sei und im Landtagsbericht zu PFAS in Bayern (nächste Ausgabe im September 2024) veröffentlicht werde. Des Weiteren stehe die Herausgabe der neuen PFAS-Leitlinien Bayern kurz bevor.
Frau Linda Dworak, Zulassungsstelle: Sachverständige am LfU Bayern, erklärte in ihrem Vortrag den Ablauf des Zulassungsverfahren für Sachverständige und hob dabei hervor, dass eine positive Einflussnahme auf das Verfahren möglich sei, da nach Aufforderung Unterlagen nachgereicht werden könnten. Des Weiteren sei nach jedem Schritt der Rückzug oder die Ablehnung des Antrags möglich. Mittels einer Grafik zeigte Frau Dworak die hohe Erfolgsquote der Zulassungsanträge mit Sachkundeprüfung der letzten Jahre auf. Weiterhin ging Frau Dworak auf die Thematik Tätigkeiten ab 01.08.2023 wie z. B. Klassifizierung von Bodenmaterial und Baggergut nach § 16 Abs. 1 S. 2 EBV durch Sachverständige im Sinne des § 18 BBodSchG und Personen mit vergleichbarer Sachkunde ein. Hierbei informierte die Vortragende, dass die Kreisverwaltungsbehörden in Bayern die vergleichbare Sachkunde im Einzelfall (Checklisten) prüfen. Sie betonte jedoch, dass Personen mit vergleichbarer Sachkunde nicht als Sachverständige nach § 18 BBodSchV tätig werden können.
Herr Dr. Felix Geldsetzer, LfU Bayern, berichtete über Aktuelles aus der Zulassungsstelle: Untersuchungsstellen. Der Vortragende ging vertieft auf die Thematik der Auftragsabklärung der Labore ein. So sollen Orientierende, Detail- und Sanierungsuntersuchungen fast immer gerichtsverwertbar sein. Gerichtsverwertbar sind Ergebnisse insbesondere, wenn sie entsprechend einem genormten Verfahren von einer zugelassenen Untersuchungsstelle erarbeitet wurden und das Regelwerk Werte (z. B. Prüfwerte) enthält, die sich auf dieses Verfahren beziehen. Zudem sei zu beachten, dass eine Notifizierung nach § 18 BBodSchG erforderlich sei, wenn ein bayerisches Wasserwirtschaftsamt der Auftraggeber ist oder die Kreisverwaltungsbehörde dies gefordert hat oder der Auftraggeber (z. B. die GAB) dies verlangt. Dann sind die Anforderungen der LAWA AQS-Merkblätter und der VSU zu erfüllen und die Untersuchungsstelle muss die Verfahren aus der Verfahrensliste zu ihrem Zulassungsbescheid (siehe www.resymesa.de) anwenden. Am Schluss seines Vortrags kündigte Herr Dr. Geldsetzer den Grundwasserprobenahme-Ringversuch 2024 an. Dies betrifft Untersuchungsstellen, die für den Teilbereich 2.1 (Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen von Wässern) in Bayern zugelassen sind. Die Auditierungen sollen vorzugsweise Juni/Juli 2024 stattfinden.
Herr Dr. Martin Biersack, LfU Bayern, ging in seinem Vortrag insbesondere auf das Wertesystem beim Merkblatt 3.8/1 ein. Er hob hervor, dass es neue Prüfwerte am Ort der Probenahme gebe und damit der Fokus auf Eluatuntersuchungen (W/F 2:1) liege. Hierzu teilte er in Bezug auf Merkblatt 3.8/5 mit, dass die aktualisierten Versionen der DIN 19528 und 19529, die 07/2023 veröffentlicht wurden, ebenfalls angewendet werden dürfen (abweichende Korngrößenfraktion, abweichendes Elutionsmittel). Frau Dr. Judith Forberg, LfU Bayern, informierte ausführlich über die Durchführung der Einmischprognose, die ergänzend zur Sickerwasserprognose v. a. zu Beginn der Detailuntersuchung (vor Bau der Grundwassermessstellen) eingesetzt werden kann. Dabei sei es wichtig zu beachten, dass diese an Anwendungsvoraussetzungen gebunden sei und alle Parameter hinreichend konservativ abgeschätzt werden müssten. Herr Roland Hammerl, LfU Bayern, stellte ausführlich die wesentlichen Änderungen im Merkblatt 3.8/4 Probenahme von Boden und Bodenluft bei Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen vor. Hierbei wies er darauf hin, dass die neue BBodSchV und die LABO-Arbeitshilfe zur Expositionsabschätzung in der aktualisierten Fassung berücksichtigt seien. Zum Abschluss des Themenblocks gab Herr Heinzel noch Hinweise zum Merkblatt 3.8/6 Grundwasserprobenahme. Hier sei u. a. zu beachten, dass das Abpumpenvolumen vor der Probenahme bestimmt werden solle, Schöpfproben nur im Ausnahmefall in Kombination mit vorherigem Abpumpen oder für spezielle Fragestellung (z. B. Phase) durchgeführt werden und Wasserproben aus Schürfen und offenen Bohrungen ausschließlich zur qualitativen Bewertung verwendet werden dürfen.
Im zweiten Themenblock Bodenkunde und Pfad Boden-Nutzpflanze ging Herr Titus Ebert, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), in seinem zweigeteilten Vortrag Aktuelle Themen zum Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze zunächst auf Änderungen im Zusammenhang mit der Novellierung der BBodSchV ein. Eine wesentliche Strukturänderung der Verordnung ist nun die Positionierung des vorsorgenden Bodenschutzes vor dem nachsorgenden. Die Arbeitshilfe „Umgang mit Bodenmaterial“ des LfL (derzeit in Überarbeitung), die als Hilfestellung für die umfangreichen Regelungen im vorsorgenden Bodenschutz dient, stellte der Referent kurz vor. Im Bereich des nachsorgenden Bodenschutzes berichtete Herr Ebert hauptsächlich über Neuregelungen bei den Prüf- und Maßnahmenwerten. Der zweite Teil seines Vortrags handelte von Uran und anderen Radionukliden in mineralischen Phosphat-Düngemitteln. So ist der Urangehalt in sedimentär gebildeten mineralischen Phosphatdünger sehr hoch und es sind in den gesetzlichen Regelungen keine Kennzeichnungsschwellen oder Grenzwerte festgelegt. In der Praxis ist jedoch nur bei stark überhöhter P-Düngung ein Anstieg der Urangehalte im Oberboden erkennbar, wobei ein Transfer des Urans in Pflanzen vernachlässigbar gering sei.
In seinem sehr anschaulichen Vortrag Wieviel KA 5 (Bodenkundliche Kartieranleitung) muss sein? referierte Herr Carlo Schillinger, LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH, über die Anwendung der KA 5 anhand vieler Beispiele aus der Praxis und ging dabei auf die Vor- und Nachteile ein. Als Vorteile nannte er insbesondere den Zwang zur exakten und objektiven Beschreibung, die Miterfassung von Merkmalen mit Einfluss auf die Bodenfunktion und die Vielzahl an Hilfestellungen für die objektive Beschreibung. Als Nachteile sieht der Referent den enormen Zeitaufwand durch die hohe Detaillierung, bei der viele aufzunehmende Daten von rein bodenkundlicher Relevanz seien und die Tatsache, dass die anhand der KA 5 aufgenommenen Bodenprofile nicht mit GeoDin darstellbar sind. Herr Schillinger betonte am Schluss seines Vortrags, dass nach § 18 Abs. 5 BBodSchV die Anwendung der KA 5 nur in dem Umfang stattfinden müsse, wie es für die jeweilige Fragestellung erforderlich sei.
Im dritten Themenblock Schadstoffe und Sanierung berichtete Herr Dr. Johannes Besold, LfU Bayern, zunächst über das LfU-Projekt zur Mobilisierung von Arsen unter Altablagerungen. Die Mobilität des Arsens ist im Wesentlichen von dessen Oxidationsstufe abhängig. So ist Arsen III (Arsenit) wesentlich mobiler als Arsen V (Arsenat). Als Grund der geringen Mobilität des Arsen V wird dessen starke Bindung an Fe(III)-(Hydr)oxide angenommen. Mit sinkendem Redoxpotenzial wird jedoch das Eisen III zu Eisen II reduziert und dadurch Arsen V freigesetzt, dass ebenfalls zu dem wesentlich mobileren Arsen III reduziert wird. Das LfU plant die Projektergebnisse im ITVA-Altlastenspektrum sowie ausführlich in einem LfU-Bericht zu veröffentlichen. Im zweiten Teil seines Vortrages ging Herr Dr. Besold auf die Identifizierung von PFAS-Eintragsquellen mit Hilfe statistischer Methoden ein. Er stellte hierzu die Methode „Principle Component Analysis“ (PCA) kurz vor, die eine Darstellung multivariater Daten in 2D sowie Möglichkeiten zur Gruppierung und Interpretation von Schadstoffquellen bietet. Die Anwendung der PCA-Methode wurde anhand eines PFAS-Eintrags auf einem Flugplatz beispielhaft dargestellt. Die PCA-Methode wird für die Interpretation von komplexen Grundwasserdaten und Hinweisen zu unterschiedlichen Quellen als nützlich angesehen, aber hierzu sind hinreichende Erfahrungen zu deren Anwendung erforderlich und es ergibt sich keine Interpretation auf den „ersten Blick“.
Anschließend gab Herr Dr. Emanuel Birle, TU München, einen Überblick über Ergebnisse von durchgeführten Aufgrabungen in Oberflächenabdichtungen von Deponien in Bayern. Ziel des F&E-Vorhabens war die Feststellung des Zustands von Oberflächenabdichtungen durch Aufgrabungen nach Liegezeiten von über 10 Jahren. Hierzu wurden auf insgesamt acht Deponiestandorten in Bayern 32 Schürfe angelegt und die einzelnen Komponenten beprobt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Rekultivierungsschichten und Entwässerungsschichten ihren Zweck auch nach über 10 Jahren erfüllen. Auch gemischtkörnige Abdichtungen halten größtenteils die Anforderungen über lange Zeiträume ein. Hingegen erfüllen geosynthetische Tondichtungsbahnen (Betonitmatten) die Anforderungen an die Permittivität nach längerer Liegezeit nur teilweise bzw. modifizierte mineralische Abdichtungen nach relativer kurzen Liegezeiten im Wesentlichen nicht mehr.
Im letzten Vortrag dieses Themenblocks stellte Herr Lukas Monz, Nickol und Partner AG, die Untersuchung und Sanierung eines MKW-Schadenfalls vor. Bei einem Betrieb zur industriellen Tierkörperverwertung und Schlachtabfallbeseitigung waren im September 2022 mehrere 10.000 Liter Heizöl ausgetreten. Der Mineralölschaden befindet sich im Zustrom eines Trinkwasserschutzgebietes mit Trinkwassergewinnung. Wesentliche Ziele waren eine Gefährdungsabschätzung für die Trinkwassergewinnung, eine Variantenbetrachtung für die Sanierung, eine Sicherung des angrenzenden Baches (Vorfluter) sowie eine schnelle Phasenabschöpfung. Als Sofortmaßnahmen wurden u. a. Ölphasen aus Schächten und Schürfgruben abgesaugt, das geförderte Öl-Wasser-Gemisch abgereinigt, der MKW-Schaden abgegrenzt, eine Öl-Austrittsstelle am Vorfluter gespundet und Abstrommessstellen errichtet. Die Variantenbetrachtung ergab als Vorzugsvariante die Nutzung der vorläufigen Sanierungsbrunnen als dauerhaft betriebene Sanierungsbrunnen. Die Sanierung erfolgte durch eine Erzeugung eines Absenktrichters zur Anreicherung der Öl-Phase in den Sanierungsbrunnen. Das abgepumpte Öl-Wasser-Gemisch wurde der Grundwasserreinigungsanlage zugeführt. Zwischenzeitlich hat sich die räumliche Ausdehnung der freien Öl-Phase deutlich verringert; in 2 von 4 Sanierungsbrunnen wird mittlerweile nahezu keine Öl-Phase mehr beobachtet. Künftig soll u. a. die Schadstoffentfrachtung bilanziert, die Betriebszustände der Sanierungsbrunnen angepasst und Abbruchkriterien zur Phasensanierung festgelegt werden.

Abschöpfung freie Phase über Druckluftpumpen, Bild von Nickol & Partner
Den Themenblock Rechtssituation und Arbeitsschutz leitete Herr Prof. Dr. Torsten Grothmann, Kanzlei Grothmann Geiser Rechtsanwälte PartG mbH, ein. Mit dem Vortragstitel Verantwortung in Zeiten des Verschwindens – Juristische Verantwortung des Sachverständigen gemäß § 18 BBodSchG ging er zunächst auf grundsätzliche Themen, wie z. B. die Rolle des Verantwortungsbewusstseins sowie der Entscheidungsbereitschaft und Eigenverantwortlichkeit ein, die seines Erachtens aktuell in der Gesellschaft immer weiter verschwinden. Wie sind aber in diesem Zusammenhang die geltenden Regeln (z. B. allgemein anerkannte Regeln der Technik – aaRdT) zu sehen, die eine wissenschaftliche Richtigkeit legitimieren sollen und als Grundlage für Verantwortung herangezogen werden können? Hierzu führte er aus, dass beispielsweise die innerhalb Deutschlands allgemein gültigen DIN-Normen per se nicht als aaRdT zu sehen seien sondern als Empfehlung. Erst nach einiger Zeit könnten sich DIN-Normen, - diese werden auch vom DIN selbst nicht als aaRdT bezeichnet - als solche etablieren. Mit Blick auf die Verantwortung des Sachverständigen legte er dar, dass dessen Aufgaben neben der Aufklärung der Sachverhalte stets eine eigenständige Prüfung (nicht Prüfung gemäß aaRdT) sei. Der Ermessensspielraum sollte entsprechend genutzt werden und Abweichungen (z. B. hinsichtlich aaRdT) dort vorgenommen werden, wo diese notwendig und sinnvoll sind. Weiterhin sollen die erforderlichen Entscheidungen im Rahmen der Sachverständigenaufgaben getroffen werden. Wesentlich dabei sei, dass bei Abweichung von Regelungen dies verantwortungsvoll begründet und dokumentiert werde.
Herr Andreas Feige-Munzig (ehem. Leiter des Referates kontaminierte Bereiche / Biostoffe der BG Bau) referierte zu den Themen Gefahrstoffverordnung 2024 (?) – Was ist Neues zu erwarten sowie Häufige Fehler im Arbeits- und Sicherheitsplan nach DGUV Regel 101-004 / TRGS 524. Anlass für die o. g. Anpassung der Gefahrstoffverordnung war v. a. die Feststellung, dass Asbest auch in Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern (PSF) festgestellt wurde. Dies machte neben der Anpassung der TRGS 519 auch eine Überarbeitung der Gefahrstoffverordnung erforderlich. Beginnend mit dem nationalen Asbestdialog (2016 bis 2020) wurden Eckpunkte der künftigen Regelungen zu Asbest festgelegt, die u. a. eine Informations- und Mitwirkungspflicht des Veranlassers (z. B. Bauherr oder Auftraggeber) sowie auf Exposition und Risiko bezogene Schutzmaßnahmen beinhalten (siehe auch Referentenentwurf 2023). Herr Feige-Munzig hob des Weiteren insbesondere auch die Mitwirkungs- und Informationspflichten des Veranlassers hervor. Das Vorhandensein von Asbest wird bei Gebäuden, die vor dem 31.10.1993 (Asbestverbotsdatum) errichtet wurden, vermutet. Gemäß Referentenentwurf 2023 bestehe eine grundsätzliche anlassbezogene Erkundungspflicht. Die jeweiligen Schutzmaßnahmen werden in einer Exposition-Risiko-Matrix dargestellt (siehe auch u. a. neue TRGS 519). Für Tätigkeiten mit Exposition bei Fasergehalten < 1.000 Fasern/m³ gelten demnach keine asbestspezifischen Anforderungen. Herr Feige-Munzig teilte ergänzend mit, dass für 2024 die Veröffentlichung der EU-Asbest-Richtlinie geplant sei, in der ebenfalls EU-Grenzwerte favorisiert werden. Im zweiten Teil seines Vortrags ging der Referent auf die häufigsten Fehler bei der Arbeitsschutzplanung (Arbeits- und Sicherheitsplan) für Arbeiten in kontaminierten Bereichen ein.
Die Resonanz auf die Veranstaltung war sehr positiv. Zu diesem schönen Erfolg trugen maßgeblich die Referierenden mit ihren interessanten und sehr aktuellen Vorträgen sowie die Moderierenden bei. Dafür an dieser Stelle nochmals ein besonderer Dank. Wir bedauern, dass es auf Grund von Netzwerkproblemen anfänglich zu Ausfällen bei der Online-Übertragung gekommen ist und arbeiten bereits mit dem Veranstalter des Markgrafensaals und der BVS an Verbesserungen. Ebenso ergeht ein Dank an die BVS für die hervorragende Organisation der Veranstaltung, sowie an alle Teilnehmenden für die rege Beteiligung und ihre Diskussionsbeiträge.
Bericht auch in GAB Kompakt 01/24, März 2024



